Versicherer fordern milliardenschweren Pandemie-Fonds von Staat und Privatwirtschaft
Die Versicherungswirtschaft schlägt aktuell einen privat-staatlichen Rettungsschirm vor, mit dem künftige Pandemie-Risiken abgesichert werden sollen. Zielgruppe sind kleine und mittlere Unternehmen. In einem Modell-Fall sollen die Betriebe verpflichtet werden, eine solche Versicherung abzuschließen: und entsprechend Beitrag zu werden.
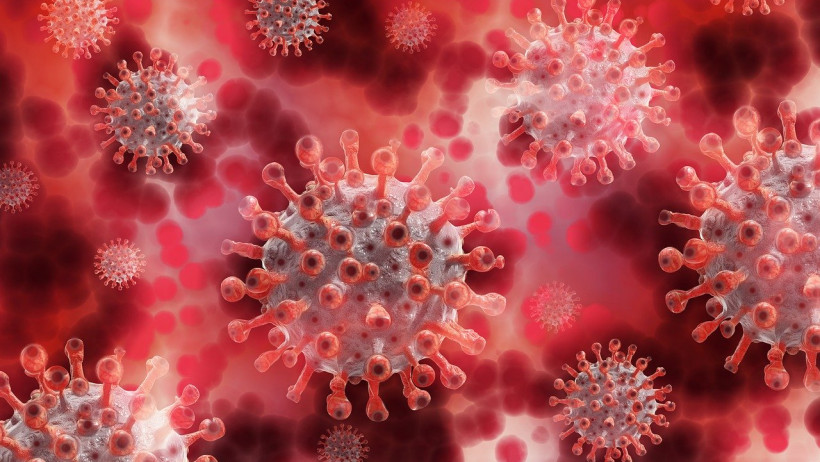
Die deutschen Versicherer schlagen aktuell einen öffentlich-privaten Fonds vor, mit dem sich künftig Firmen gegen Pandemie-Risiken absichern können. Finanziert werden soll er sowohl über Beiträge der einzahlenden Betriebe sowie über staatliche Anleihen und Steuermittel. Das geht aus einem Arbeitspapier der Versicherungswirtschaft hervor, welches der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Freitag auf seiner Webseite veröffentlicht hat.
Anzeige
Mehrere Versicherer-Vorstände hatten bereits zu Beginn des Corona-Lockdowns argumentiert, dass die Privatwirtschaft Pandemie-Risiken nicht allein versichern können. Wenn ganze Wirtschaftszweige stillgelegt werden, sei das für die Versicherer nicht kalkulierbar und könnte die Branche selbst in Existenznöte bringen, so das Argument.
So sagte etwa R+V-Chef Norbert Rollinger in einem Interview Mitte April: „Jetzt ist die Wirtschaft fast völlig zum Erliegen gekommen – das ist ein einmaliges Phänomen und die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Solche gewaltigen wirtschaftlichen Schäden kann unsere Branche finanziell nicht schultern und deshalb gibt es für solche Fälle auch keine Versicherungen – wie übrigens gegen Kriege auch nicht“. Allein in Deutschland sei für die Versicherer ein Schaden von mehreren hundert Milliarden Euro zu erwarten, wenn für alle Pandemie-Risiken gezahlt werden müsse: bei Prämieneinnahmen von insgesamt nur 200 Milliarden Euro.
Öffentliche Hand soll helfen
Nun also soll es ein gemeinschaftlicher Rettungsschirm von Staat und Privatwirtschaft richten, so wird im Positionspapier des GDV gefordert. „Wir wollen die Diskussion über ein System anstoßen, das die wirtschaftlichen Folgen künftiger Infektionswellen abmildern und staatliche Ad-hoc-Hilfen teilweise ersetzen könnte“, sagt GDV-Geschäftsführer Jörg Asmussen. „Corona hat gezeigt, dass vielen Unternehmen in einer Pandemie ohne schnelle finanzielle Unterstützung die Insolvenz droht.“
Kern des GDV-Vorschlags ist eine rechtlich eigenständige Einrichtung mit einem Kapitalstock in Milliardenhöhe. Die Beiträge werden durch Leistungen von Erst- und Rückversicherern sowie Kapitalmarktinstrumente wie beispielsweise Katastrophenanleihen ergänzt, die im Pandemiefall abrufbar wären. „Erst wenn der Kapitalstock aufgebraucht ist, würden zusätzliche staatliche Mittel abgerufen“, betont Asmussen.
Der Haken: Versicherungspflicht für kleine und mittlere Betriebe?
Dass die Versicherer mit ihrem Vorstoß selbstlos agieren, kann aber zumindest infrage gestellt werden. Denn natürlich sollen auch die betroffenen Betriebe ihren Beitrag leisten. Und zwar nicht unbedingt freiwillig. Der Versicherer-Verband schlägt demnach im Positionspapier zwei Modelle vor: zumindest eins soll die Unternehmen zu Beiträgen verpflichten.
- Modell A sieht eine Kapitalsammelstelle vor, die über die Zeit mit pauschalierten Abgaben einen Kapitalstock aufbaut und bei einer Infektionswelle (weitgehend pauschalierte) Leistungen auszahlt. Die Zielgröße des Kapitalstocks würde sich primär nach der Frage bestimmen, wieviel Tage oder Wochen das System Leistungen erbringen könnte, bevor die Reserven erschöpft sind. Diese Zeitspanne steht wiederum in Abhängigkeit von Infektionsszenarien und der Höhe der Leistungen.
- Modell B sieht ein stärker risikoorientiertes, von der Wahrscheinlichkeit eines Schadeneintritts geprägtes System vor, in dem Betriebe auf einen festgelegten Zielschaden einzahlen, den sie ersetzt bekommen wollen. Jeder Betrieb könne selbst bestimmen, welche Leistungen er im Infektionsfall erhalten möchte. Hierfür zahlt er einen Beitrag an die Kapitalsammelstelle, der sich an einer sogenannten Wiederkehrperiode (ein Schaden in X Jahren) orientiert, die beim Aufbau des Systems festzulegen wäre.
Der Nachteil von Modell A aus Sicht der Gewerbebetriebe: besagte Versicherungspflicht. "Angesicht der zu erwartenden adversen Selektion wird sich der Kapitalstock bei Modell A nicht allein durch freiwillige Zahlungen einzelner Betriebe aufbauen lassen. Es wird daher eines Pflichtsystems bedürfen", schreibt der Versicherer-Verband.
Doch auch Modell B könnte Nachteile haben: abhängig davon, wie stark die Versicherer eine Risiko-Selektion betreiben. So sollen sich die Prämien und Leistungen an der "betriebswirtschaftlichen Situation und der Größe" der Firma orientieren. Es wäre zu erwarten, dass Firmen mit sehr hohen Ausfall-Risiken auch umso höhere Prämien zahlen müssten, für manche Firmen eine solche Pandemie-Versicherung folglich unerschwinglich wird.
Anzeige
Doch auch für Modell B schlägt der GDV ein Modell vor, um die Kosten für die Firmen bezahlbar zu halten: wenn auch auf Kosten des Steuerzahlers. "Um die Zahlungen in einem akzeptablen Rahmen zu halten, würden sich diese an einer hohen Wiederkehrperiode des Leistungsfalles – z. B. 100 Jahren – bemessen. Tritt der Leistungsfall früher ein, würde der Staat die Leistungen auffüllen", heißt es im Positionspapier. Mit anderen Worten: Je öfter ein solches Ereignis eintritt, umso mehr kämen die Bürger für den Schaden auf.


