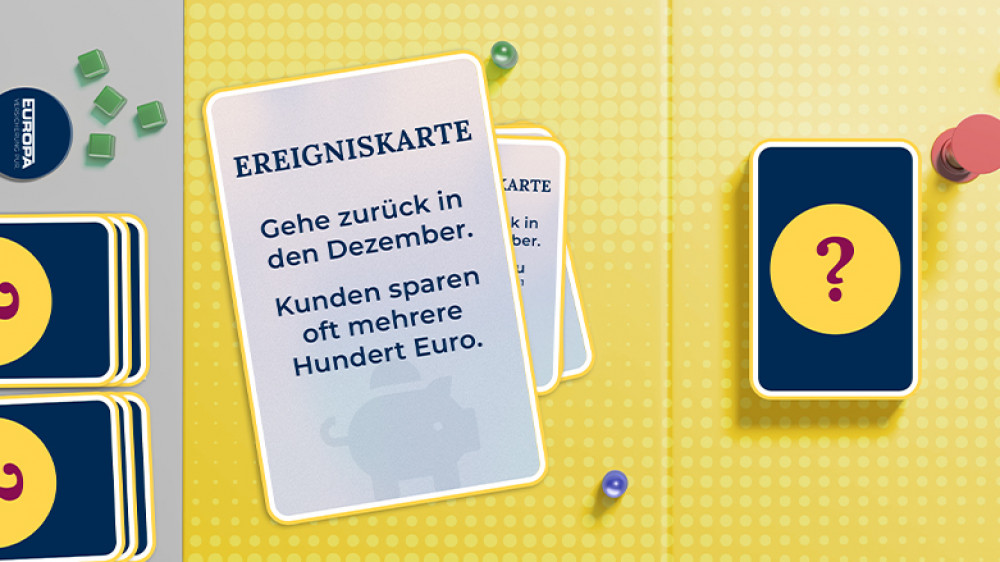Pflegeversicherung: Pflege-Reform von 2017 Hauptursache für Kostenanstieg
Die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland explodiert förmlich. Doch nur ein Bruchteil des Anstiegs ist dem demografischen Wandel gescchuldet. Vor allem die Pflegereform von 2017 treibt die Zahlen und Kosten massiv nach oben.

Die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland ist in weniger als einem Jahrzehnt dramatisch gestiegen: von 3,0 Millionen im Jahr 2015 auf 5,7 Millionen im Jahr 2023. Das entspricht nahezu einer Verdopplung. Doch nur rund 15 Prozent dieses Anstiegs lassen sich durch die alternde Bevölkerung erklären. Das zeigt Pflegereport 2025 der Barmer. Der tatsächliche Treiber ist die Pflegereform von 2017. Mit der Einführung der Pflegegrade wurden die Zahl der Leistungsberechtigungen deutlich ausgeweitet.
Anzeige
Der Anteil der Pflegebedürftigen an der Gesamtbevölkerung kletterte zwischen 2015 und 2023 von 3,21 auf 6,24 Prozent. Von diesem Zuwachs um 3,03 Prozentpunkte sind lediglich 0,44 Prozentpunkte auf demografische Entwicklungen zurückzuführen. Der Rest entsteht durch die Umstellung der Pflegestufen auf Pflegegrade und den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff, der den Zugang zu Leistungen erheblich erleichterte.
„Ein Hauptgrund für den Anstieg der Pflegebedürftigen ist der seit Januar 2017 geltende neue Pflegebedürftigkeitsbegriff. Er hat neben der Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade zu einer deutlichen Leistungsausweitung geführt. Durch die leichtere Inanspruchnahme von Pflegeleistungen wurden immer mehr Menschen als pflegebedürftig anerkannt und haben frühzeitig Unterstützung erhalten“, sagt Studienautor Prof. Dr. Heinz Rothgang von der Universität Bremen.
Diese Erkenntnisse kommen zu einem heiklen Zeitpunkt. Denn die Bund-Länder-Arbeitsgruppe soll noch dieses Jahr Eckpunkte für eine große Pflegereform vorlegen. Doch im „Zukunftspakt Pflege“ gilt eine strikte Vorgabe: Vorschläge dürfen keine zusätzlichen Kosten verursachen, sofern diese nicht unmittelbar auf die demografische Entwicklung zurückzuführen sind. Gerade das aber ist laut Barmer nicht der Fall.
Barmer-Vorstandschef Prof. Dr. Christoph Straub warnt vor einer „Mammutaufgabe“. Die Pflegeversicherung sei durch die Leistungsausweitungen der letzten Reform massiv unter Druck. Ein weiteres Abwälzen der Kosten auf Beitragszahler sei nicht tragbar. Stattdessen müssten Bund und Länder deutlich mehr Verantwortung übernehmen. Dies könne etwa durch die vollständige Übernahme der Rentenbeiträge für pflegende Angehörige oder die Entlastung der Pflegebedürftigen bei Investitionskosten und Ausbildungskosten geschehen.
Der Pflegereport zeigt außerdem, dass die gestiegene Zahl an Pflegebedürftigen nicht durch eine höhere Krankheitslast verursacht wird. Untersucht wurden sechs akute und sechs chronische Erkrankungen – darunter Krebs, Demenz, Parkinson, Hirninfarkt und Herzinsuffizienz. Zwar steige bei allen Erkrankungen der Anteil der Personen, die pflegebedürftig sind. Doch der Hauptgrund sei auch die Pflegereform von 2017. Denn diese ermögliche einen früheren Zugang zu Pflegeleistungen.
Demenz bleibt einer der stärksten Treiber für stationäre Pflege. Menschen mit Demenz werden laut Report im Schnitt rund zweieinhalb Monate länger stationär gepflegt als andere Pflegebedürftige. Parkinson-Patienten verbleiben zudem im häuslichen Pflegegeldbezug rund zwei Monate länger als Betroffene ohne Parkinson-Syndrom. In den ersten 25 Monaten seit Beginn der Pflegebedürftigkeit stieg die durchschnittliche Pflegezeit zwischen 2018 und 2022 um einen halben Monat – unabhängig von der Erkrankung selbst.
Straub fordert daher ein neues „Primärversorgungssystem“, das Patientenströme besser steuert und frühzeitig unterstützt. Nur so könne die pflegerische Versorgung unabhängig von Einkommen, Wohnort und Versicherungsstatus gewährleistet bleiben und gleichzeitig die Pflegeversicherung finanziell stabilisiert werden.