Zurich Deutschland-Chef will keine "Alibi-Digitalisierung"
Carsten Schildknecht, seit wenigen Monaten Chef der Zurich Deutschland, hat sich in einem Interview zu der Digitalisierungs-Strategie des Versicherers geäußert. Dabei machte er deutlich, dass die komplette IT des Versicherers von Grund auf saniert werden muss. Zwei Drittel seien aber bereits umgesetzt.
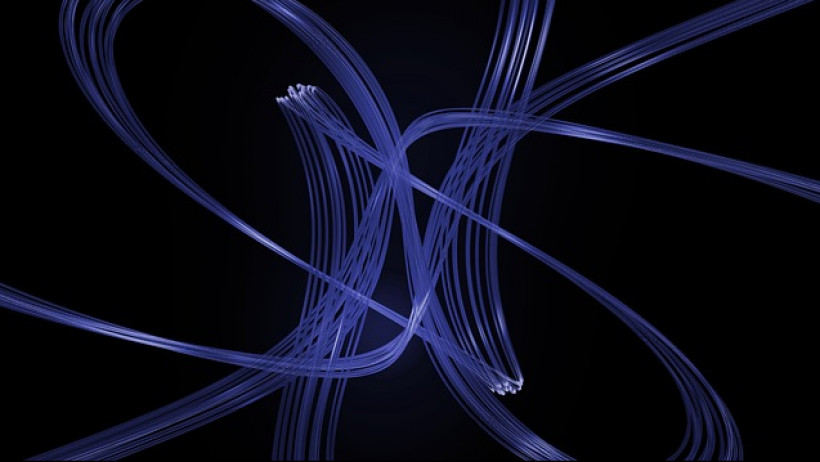
- Zurich Deutschland-Chef will keine "Alibi-Digitalisierung"
- Umbruch im Konzern
Seit dem 1. Februar 2018 ist Carsten Schildknecht Chef der Zurich Versicherung in Deutschland. In einem Interview mit „Versicherungswirtschaft Heute“ nahm er nun da zu Stellung, wie der technische Umbau des Versicherers voranschreitet. Und dieser war angesichts veralteter Strukturen sehr schmerzhaft, wie Schildknecht deutlich machte.
Anzeige
Das System von Grund auf umgekrempelt
Die Digitalisierung dürfe „keine Alibilösung“ und „kein Selbstzweck“ sein, positioniert sich Schildknecht in dem Interview. Stattdessen sei sie ein Mittel, „um unsere Kunden und Vertriebspartner durch smarte, einfache und intuitive Lösungen nachhaltig zufriedenzustellen und zu begeistern“. Über intelligente Lösungen sollen Kundenbedürfnisse erfüllt werden, „wie, wo und wann auch immer Kunden dies wünschen“, führt der Manager weiter aus. Zugleich gelte es, die Produktivität in Vertrieb und Verwaltung signifikant zu steigern.
So weit, so erwartbar. Doch was Schildknecht hier im Unternehmenssprech kommuniziert, bedeutet für den Versicherer einen teuren und radikalen Umbruch, wie der Manager im weiteren Verlauf erläutert. Bei veralteten IT-Strukturen gebe es zwei Strategien: eine „grundlegende Erneuerung der Kernsysteme und dann die Digitalisierung der Frontends“, so der Vorstand. Oder, neue digitale Frontends an die bestehenden IT-Strukturen anbinden und mit „Robotic Solutions“ und „Workarounds“ überbrücken. Langfristig sei die erste Strategie die bessere.
Das klingt sehr technisch, doch dahinter verbirgt sich ein einfacher Gedanke. Mit „Frontends“ gemeint sind kunden- und nutzernahe Anwendungen, etwa Apps zum Melden und Abwickeln von Schäden oder Programme zum Verwalten von Daten. Statt diese nun einfach mit der alten IT kompatibel zu machen, krempelt die Zurich ihre komplette IT von Grund auf um, um dann auf Basis der neuen Systeme entsprechende Nutzeranwendungen zu entwickeln. Das erleichtert es, Anwendungen einzubinden.
Vereinzelt nachbessern wäre teurer
Die Zurich ist sicher nicht der einzige Versicherer, der nach diesem Prinzip verfährt. Auch andere große Versicherer krempeln ihre IT-Strukturen komplett um, damit sie darauf aufbauend Nutzeranwendungen entwickeln können, etwa die Allianz, Ergo oder Axa.
Doch Schildknecht nennt einen wichtigen Aspekt, weshalb das notwendig ist - es wäre schlicht auf lange Sicht teurer, neue Software und Nutzeranwendungen in eine veraltete IT einzubinden. Dies erzeuge einen „sehr komplexen Flickenteppich, der schwer zu warten ist, dazu langsam in Anpassungen sowie nicht skalierbar und extrem teuer ist“.
Vergleichbar ist das vielleicht mit einem alten Betriebssystem, für das keine aktuelle Software und keine Updates mehr bereitgestellt werden. Wer es dennoch weiterhin nutzen will, muss entsprechende Lösungen selbst entwickeln und einpflegen sowie Brückentechniken entwickeln, um neue Anwendungen mit alter Technik kompatibel zu machen. Eine Arbeit, die Zeit und Aufwand erfordert. Auch Verbesserungen des Betriebssystems sind nicht nutzbar, wenn man weiterhin das alte nutzen will. Fehler und Schwachstellen werden mitgetragen und müssen bearbeitet werden.
Anzeige
Das erklärt auch, warum viele Versicherer ihre Technik derart radikal umkrempeln: alles muss auf den Prüfstand. “Am Ende des Tages muss die Digitalisierung das ganze Unternehmen und alle Prozesse erfassen und darf keine Alibilösung sein“, sagt Schildknecht. Diese umfassende Strategie befreit freilich nicht davon, dass auch die neue IT-Struktur ständig überarbeitet und weiterentwickelt werden muss.
Umbruch im Konzern
Dass bei der Zurich etwas passieren musste, ist klar. Die Schweizer Gruppe hat mehrere Krisen und Umbauprogramme hinter sich, der Konzern entpuppt sich als Dauerbaustelle. Seine Policen galten lange Zeit als vergleichsweise teuer - auch wegen veralteter und doppelter Strukturen in Vertrieb und Verwaltung.
Tiefpunkte der jüngeren Firmengeschichte waren die Freitode des Finanzchefs Pierre Wauthier im August 2013 sowie des früheren CEOs Martin Senn im Mai 2016. Beide Suizide wurden mit dem hohen Druck im Konzern in Verbindung gebracht. Grundsätzlich entpuppte sich die Vorstandsetage des Versicherers als Schleudersitz. Zum Jahresanfang 2018 mussten mit Jörg Bolay, Gerhard Frieg und Alexander Libor gleich drei Vorstände gehen. Der neue Deutschland-Chef Carsten Schildknecht folgte im Februar auf Markus Nagel, der weniger als zwei Jahre im Amt war und das Unternehmen auf eigenen Wunsch verließ. Auch Nagels Ausscheiden kam für viele überraschend und wurde von Branchenbeobachtern als Beleg für die Unruhe im Konzern gewertet.
Anzeige
Vorangegangen waren Jahre der Krise. 2016 musste der Schweizer Versicherer eine Gewinnwarnung herausgeben, nachdem der Gewinn im Vorjahr um mehr als die Hälfte eingebrochen war. Das Minus resultierte auch aus den Kosten des radikalen Konzernumbaus infolge der Digitalisierung, das der neue Konzernchef Mario Greco den Eidgenossen verordnet hatte. 8.000 Stellen wurden im selben Jahr zur Disposition gestellt, in Deutschland sollten hiervon 500 Stellen wegfallen. Seitdem befindet sich der Versicherer auf dem Pfad der Erholung. 2016 haben die Eidgenossen einen Gewinn von 3,8 Milliarden Dollar geschrieben, 2017 von 3,0 Milliarden Dollar.
Die Schweizer richten auch ihr Geschäft neu aus. Unter anderem trennte sich der Konzern vom Krankenhaushaftpflicht-Geschäft in Deutschland, das zum 31. Dezember 2016 Reserven von rund 450 Millionen Dollar umfasste (der Versicherungsbote berichtete). In der Schadensbearbeitung soll verstärkt künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen. Ab 2020 verliert man mit dem Automobilclub ADAC zudem einen wichtigen Partner in der Kfz-Versicherung an die Allianz. Mehrfach wurde in der Branche über eine Übernahme der Schweizer Gruppe durch den Münchener Wettbewerber spekuliert.
- Zurich Deutschland-Chef will keine "Alibi-Digitalisierung"
- Umbruch im Konzern



