Allianz-Digitaloffensive: von Kaffeebechern, Schreibmaschinen und Hundefreunden
Beim 18. Vorlesungstag in Leipzig sprach Allianz-Vorstand Bernd Heinemann über das Digitalisierungskonzept der Allianz - eigentlich. Diese Glosse lenkt den Blick auf das, was Heinemann eher am Rande erzählte, und dennoch viel mit Versicherungstrends zu tun hat.
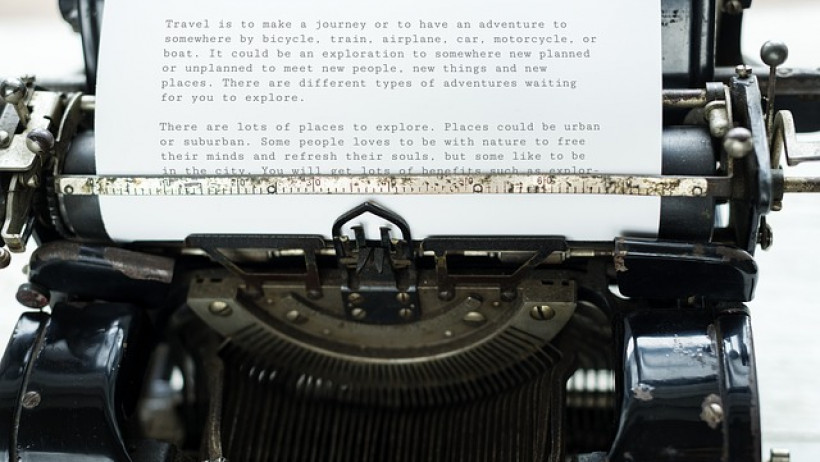
- Allianz-Digitaloffensive: von Kaffeebechern, Schreibmaschinen und Hundefreunden
- ...wenn die Versicherer entbehrlich werden könnten...und es doch nicht sind
Es hat sich vor mehreren Jahren zugetragen: Ein Mann steht am Straßenrand in San Francisco und will ein Taxi herbeiwinken. Er ist nicht zum ersten Mal in der Stadt und hat die Erfahrung gemacht, dass es problemlos möglich ist ein Taxi anzuhalten. Doch wie er auch steht und wartet: es kommt keins. Auch eine Telefonnummer findet er nicht. Also geht er in den Laden und fragt, ob er dort ein Taxi rufen kann. Eine Frau klärt ihn auf: Hier gibt es keine normalen Taxis mehr. „Na ja, Sie brauchen jetzt diese App: Uber.“ Jene App also, mit der man private Fahrer als Taxi ordern kann.
Anzeige
Die Episode ist Bestandteil eines Vortrages beim 18. Vorlesungstag an der Universität Leipzig, veranstaltet vom hiesigen Institut für Versicherungswirtschaft. Der Mann, der sie erzählt, ist Bernd Heinemann. Vorstand der Allianz Deutschland, dort für Marktmanagement verantwortlich. Und er erzählt sie, um seinen Zuhörern zu verdeutlichen, was das Modewort „Disruption“ bedeutet. Nämlich die Gefahr, dass etablierte Marktteilnehmer vom Markt verschluckt werden, förmlich überrollt. Plötzlich überflüssig sind. Dass sie verschwinden, obwohl sie sogar ein Monopol hatten. Sie haben einen Trend verpasst: und sind nicht mehr existent.
"Software ate my world"
Auch Versicherern könnte passieren, dass sich plötzlich überflüssig sind. Heinemann wählt zum Einstieg in seinen Vortrag ein Zitat von Marc Andreessen, Mitbegründer des IT-Dienstleisters Network Communications: “Software is eating the world.” Wobei er das Zitat in die Vergangenheit setzt, weil der Prozess ja bereits unaufhaltsam angeschoben wurde: „Software ate my world“. Dass Apps, Bytes und Chainbots auch die Versicherungsbranche durcheinandergewirbelt haben, wird niemand bestreiten.
Selbst die Allianz könnte verschluckt werden, größter Versicherungskonzern Europas. Heinemann erzählt von seinem Erstaunen, als er eine Liste aus den 60er Jahren vorfand, auf der die 50 größten deutschen Unternehmen der damaligen Zeit aufgeführt waren. 26 dieser Firmen existieren heute nicht mehr. Sie waren groß, sie sind verschwunden. Sie haben irgendwann den Anschluss verpasst.
Dieses Verschwinden hat nichts mit Qualität zu tun, zumindest nicht ausschließlich. Eines der damals erfolgreichen Geschäftsmodelle: das Kaffeehaus. Man ging in ein Bistro, stellte sich dort an den Stehtisch, bekam Kaffee für damals 60 Pfennige. Hochwertigen Kaffee aus guten Keramik- oder gar Porzellan-Tassen. Ein revolutionäres Konzept: man trank den Kaffee nicht mehr zu Hause, sondern verkaufte ihn als Getränk für zwischendurch.
Dann begannen plötzlich einige Wettbewerber furchtbar neumodisches Zeugs: sie mischten Milchschaum und Espresso hinein, sogar künstliche Aromen, verkauften den Kaffee in Pappbechern, völlig überteuert. Viele Kaffeehausbetreiber schüttelten den Kopf: „fürchterlich!“ So ein Irrsinn könne sich doch nicht durchsetzen. Doch die Etablierten von damals haben schlicht übersehen, dass gerade der scheinbare Nachteil Vorteile brachte: einen Pappbecher konnte man mitnehmen, den Kaffee unterwegs trinken. Der Latte im Pappbecher war das disruptive Element. Und Starbucks, 1971 gegründet, wurde die größte Kaffeehauskette der Welt mit 19 Milliarden US-Dollar Umsatz.
Als die Schreibmaschine noch Innovationen hervorbrachte
Heinemann nutzte dieses Beispiel, um das Problem des „Innovations-Dilemmas“ anzusprechen, ein Begriff, den der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Clayton M. Christensen populär gemacht hat. Stark vereinfacht besagt dieses Dilemma, dass große und etablierte Unternehmen durchaus Neues anstoßen können. Aber auf halber Strecke stecken bleiben, weil man an etablierten Strukturen festhält und sich in seinen Erfolgen sonnt. Also kommen radikalere Wettbewerber, oft jung und hungrig, die diese Impulse konsequenter zu Ende denken – und sich das gesamte Geschäftsfeld wegschnappen.
Beispiel Schreibmaschine: einige Firmen feierten es in den 80er Jahren als wegweisend, dass man plötzlich Tippfehler auf der Schreibmaschine korrigieren konnte, indem Zeilen mit einem Mechanismus gelöscht und überschrieben wurden. Die Modelle verkauften sich auch gut. Die Hersteller fühlten sich sicher, sie hatten Erfolg. Dann kamen Computer-Schreibprogramme wie „Word“ - und setzten das Prinzip, Text nachträglich korrigieren zu können, weit konsequenter um. Plötzlich wirkte die scheinbare Innovation rückständig, die Schreibmaschine verschwand.
Anzeige
Da kann es gelten, verpasste Trends aufzuspüren und auf den fahrenden Zug noch aufzuspringen. Als Allianz-Vorstand Heinemann vor Jahren mit dem Chef von Lyft sprach, einem US-Unternehmen, das ähnlich funktioniert wie Uber: man ordert private Autos als Taxi, klagte der Start-up-Unternehmer, dass ihnen der passende Versicherungsschutz für die Fahrer fehle. Denn eine private Kfz-Haftpflicht greift nun mal nicht, wenn das private Auto quasi gewerblich genutzt wird. Es wäre eine Chance für Versicherer gewesen, hier in die Bresche zu springen. Wenige Monate später traf Heinemann erneut den Lyft-Chef, und dieser sagte: „Jetzt brauchen wir Euch nicht mehr! Wir machen es einfach selbst!“ Der Grund: Lyft sammelt so viele Daten darüber, wann ein Fahrer wie und wo fährt, dass sie die Kfz-Versicherung einfach selbst anbieten können, freilich über ein Rückversicherungs-Konzept.
...wenn die Versicherer entbehrlich werden könnten...und es doch nicht sind
...das Beispiel des Lyft-Taxidienstes zeigt am deutlichsten, dass eben auch die etablierten Versicherer entbehrlich werden könnten, wenn andere Firmen ausreichend Daten sammeln, selbst ein Weltriese wie die Allianz. Doch Heinemann hat, mag das bis jetzt auch nicht deutlich geworden sein, vor allem darüber gesprochen, wie der Münchener Versicherer seine eigene Verzichtbarkeit abwenden will. Die Antworten darauf sind smart – und verblüffend einfach. Auch, wenn natürlich niemand sagen kann, ob sie tatsächlich funktionieren.
Eine „konsequente Kundenorientierung“ strebe die Allianz an, so Heinemann als Fazit. Das klingt zunächst nach einer abgelutschten Marketingphrase, was es tatsächlich auch ist. Doch der Allianz-Vorstand machte in seinem Vortrag deutlich, dass damit viele strategische Entscheidungen verknüpft sind, auch Irrwege, weil der Kunde sich eben doch nicht so verhält, wie es in den Hinterzimmern von PR-Agenturen und Versicherern gemutmaßt wird, sondern sich selbst auf die Reise begibt, ein Abenteurer ist. Und kaum glaubt man, den Kunden zu kennen, ist er schon woanders, hat andere Vorlieben entwickelt, geht fremd und ist verschwunden.
Anzeige
Der Kunde begibt sich selbst auf die Reise
Das versuchte Heinemann am „One-2-many“-Ansatz zu erläutern. Früher ging der Vermittler zum Kunden, war quasi das Medium, durch das der Versicherer sprach, und die eigene Marke wurde durch Werbung bekannt gemacht wie etwa dem bekannten TV-Spot der 80er, bei dem ein gut geföhnter Mann in Italien in den Tomatenstand brettert.
Nun aber begibt sich der Kunde selbst auf die Reise, recherchiert im Internet, erst bei Google, dann bei Check24 und Verivox, informiert sich in Online-Foren und bei Freunden, springt und switcht. Die Möglichkeit, im Netz zu bewerten, gibt dem Kunden auch eine ganz neue Macht, selbst daran mitzuwirken, welche Versicherung andere Kunden abschließen. Von „Costumer Journey“ spricht man, auch das kein neues Konzept, und „diese Reise ist nicht mehr gesteuert, sondern der Kunde definiert sie selbst“, so Heinemann.
Bei all der neuen Macht lässt sich der Kunde auch gern täuschen. Logarithmen erlauben es, dem Kunden den Eindruck zu vermitteln, dass man mit ihm persönlich kommuniziert und mit seinen individuellen Bedürfnissen anspricht, obwohl sich doch dahinter nur die technische Auswertung des eigenen Nutzungsverhaltens verbirgt. Onlinegiganten wie Google, Amazon oder Facebook schaffen es perfekt, diese Illusion der direkten Ansprache zu erzeugen: sie locken mit passgenauen Ergebnissen, „Mein Buch, meine Reise, mein Partner“, so als würde da am anderen Ende jemand sitzen, der einen ganz genau kennt und versteht.
"Ändert sich denn jetzt alles?"
Auch die Allianz will an diesen technischen Möglichkeiten partizipieren, und doch nicht alles neu machen. „Ändert sich denn jetzt alles?“, fragt Heinemann. Und verneint. Denn auch die Versicherungswirtschaft habe Stärken, wobei Empathie und der persönliche Faktor entscheidend seien: „Die Kunden sind früher nicht zum Vertreter gegangen, weil das bequem war, sondern weil sie einen persönlichen Ansprechpartner suchten“, sagte Heinemann. Deshalb ziele die Strategie der Allianz auf den Hybrid-Kunden, der sowohl online wie offline aktiv ist. Online will der Versicherer möglichst viele Kontaktpunkte bieten, aber auch in der Fläche mit den eigenen Agenturen präsent sein, denn wenn der Kunde abends zu einer Agentur gehe, weil er Rat sucht, aber diese ist geschlossen, geht er im Zweifel zum Wettbewerber, dessen Agenturbüro noch offen ist.
Selbst in der Autoversicherung, jenem Bereich, der am meisten online abgeschlossen wird, seien in den letzten Jahren vor allem die RoPo-Abschlüsse gestiegen ("Research Online, Purchase Offline"), erklärt Heinemann. Also jene, bei denen der Verbraucher erst im Netz recherchiert und dann doch persönlich zu einem Vermittler geht. Er glaube deshalb auch nicht, dass das gesamte Geschäft ins Netz abwandere, im Gegenteil: die Direktversicherer haben eher Marktanteile abgegeben. Gemäß den Ausführungen könnte man sagen: weil sie nicht genug empathiefähig sind.
Allianz bei Facebook funktioniert nicht ohne Agenturen
Eine sympathische Erkenntnis ist hierbei, dass die traditionellen Agenturen wichtig sind, um die digitale Strategie der Allianz zu stützen. Heinemann erläuterte das am Facebook-Auftritt des Versicherers. Zunächst hatte die Allianz eine einzige Facebook-Seite, die ganz nach der Corporate-Idee betrieben wurde: eine Mischung aus Unternehmens-News und Verbrauchertipps. „Komplett irrelevant“ sei diese Seite gewesen, so Heinemann, immerhin 200.000 Likes sammelte man ein, aber um den Kunden abzuholen und anzusprechen, brachte sie wenig.
Da erkannte die Allianz, dass sie ihre Agenturen braucht, um bei Facebook auch in die Weite zu wirken. Jeder Agentur wird es nun gestattet, ihren eigenen Facebook-Auftritt zu pflegen. Die Accounts können mit Inhalt bestückt werden, den die Allianz zur Verfügung stellt, aber auch mit eigenen und persönlichen Inhalten: Jeder Vermittler kann sich mit seinen Hobbys und Vorlieben präsentieren, seinen Themen, seinen Spleens.
So wurde ein ganzes Netz an Anknüpfungspunkten geschaffen: Profile mit ganz unterschiedlichen Themen und Arten der Ansprache, die weit besser die Marke Allianz präsentieren als die eigene Corporate-Seite. Heinemann verdeutlichte dies am Facebook-Profil eines Kölner Vermittlers. Dieser ist Hunde-Freak, auf dem Profilfoto der Agentur umarmt er einen Hund, viele seiner Fotos zeigen die Familienhunde, und er tauscht sich oft und gern mit anderen Hundehaltern aus. So wurde er zu einem kleinen Star der Hundeversicherung, vermittelt jährlich 4.000 Verträge allein in diesem Segment, und zwar bundesweit. Es ist der persönliche Faktor, der auch hier den Ausschlag gibt.
Anzeige
Es gehe darum, "das richtige Alte zu bewahren und das richtige Neue dazuzupacken", so Heinemann. Jede Agentur erhalte zum Beispiel ihre eigene Webseite und könne die Online-Instrumente der Allianz-Webseite nutzen. Weil die Allianz aber auch Innovationen nicht gegen sich laufen haben will, hat sie eine Art Versuchslabor geschaffen, ausgestattet mit Milliarden: Allianz X, die Start-ups mit allerlei Zukunftsideen päppelt und nicht ganz selbstlos auch bindet. Drei Beispiele: Bima bietet Mikroversicherungen für Schwellenländer an, mit Kleinunternehmern als Zielgruppe, deren Einkommen geradeso zum Überleben reicht. Und der digitale Versicherer Lemonade bastelt an Tarifen ohne Schaden-Kosten-Quote.
- Allianz-Digitaloffensive: von Kaffeebechern, Schreibmaschinen und Hundefreunden
- ...wenn die Versicherer entbehrlich werden könnten...und es doch nicht sind




