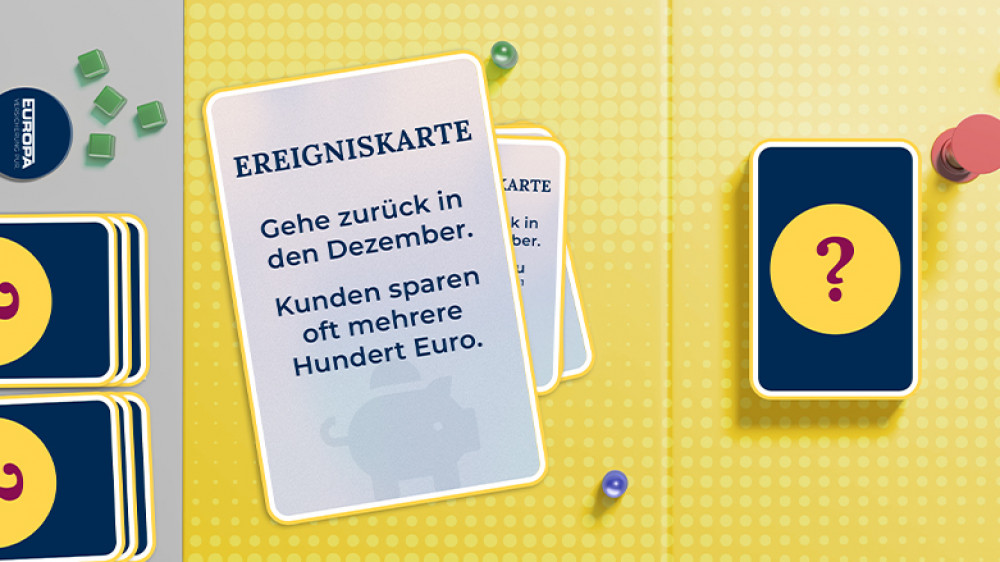Das Kollektiv wankt – warum die Wohngebäudeversicherung neu gedacht werden muss
Einige Versicherer stellen ihr Neugeschäft in der Wohngebäudeversicherung ein. Es ist ein Alarmsignal für die gesamte Branche. Klimarisiken, steigende Sanierungskosten und regionale Rückzüge bringen das Prinzip des Risikoausgleichs ins Wanken. Wie Makler, Eigentümer und Versicherer jetzt reagieren sollten, erklärt Versicherungsmakler Kevin Klöber aus Darmstadt.

Steigende Schäden, regionale Rückzüge und unbezahlbare Prämien: Die Grundidee des Risikoausgleichs steht auf dem Prüfstand. Warum das bisherige System an seine Grenzen stößt – und weshalb es jetzt neue Ansätze braucht.
Anzeige
Als letzte Woche der dritte Versicherer innerhalb eines Monats sein Neugeschäft in der Wohngebäudeversicherung einstellte, war klar: Was sich seit Monaten andeutet, ist jetzt Realität. In über 20 Jahren als Versicherungsmakler habe ich viele Marktzyklen erlebt – aber das hier ist anders. Versicherer kündigen Altbestände, andere nehmen keine neuen Risiken mehr an, selbst bei einwandfreien Objekten. Die Prämien? Steigen im Jahrestakt zweistellig. Für alle Beteiligten – Eigentümer, Verwalter, Makler – ist das Neuland.
Was wir erleben, ist kein vorübergehendes Marktrauschen. Die Kombination aus Klimarisiken, explodierten Baukosten und wirtschaftlichem Druck bringt die Wohngebäudeversicherung an ihre Grenzen.
Ein Markt im Umbruch
In vielen Regionen ist es mittlerweile schwer, überhaupt noch eine Wohngebäudeversicherung zu bekommen. Besonders dort, wo Starkregen, Sturm oder Hagel regelmäßig zuschlagen, ziehen Versicherer sich zurück. Ganze Postleitzahlbereiche gelten als „rote Zonen" – Neuabschlüsse? Kaum möglich oder nur zu Prämien, die sich niemand leisten kann.
Die Gründe liegen auf der Hand: Die Schadenssummen sind massiv gestiegen. Laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) lagen die Schäden durch Naturgefahren 2023 bei rund 5,7 Milliarden Euro. Gleichzeitig haben Inflation und Lieferkettenprobleme die Bau- und Sanierungskosten in die Höhe getrieben. Reparaturen, die früher ein paar tausend Euro kosteten, liegen heute schnell im fünfstelligen Bereich.
Dazu kommt: Viele Versicherer kämpfen mit Altbeständen, die über Jahrzehnte zu niedrig kalkuliert wurden. Die Folge? Der Markt sortiert sich neu – oft zulasten der Versicherten.
Doppelte Belastung für Eigentümer und Verwalter
Für Eigentümer und Hausverwaltungen bedeutet das vor allem Unsicherheit. Bestehende Verträge werden ständig überprüft, Selbstbeteiligungen steigen, und besonders Leitungswasserschäden geraten in den Fokus. Wenn Rohrleitungen veraltet sind oder Sanierungen verschleppt wurden, verschärfen Versicherer ihre Auflagen oder passen Verträge an. In Mehrparteienhäusern führt das regelmäßig zu heftigen Diskussionen – vor allem, wenn die Versicherungskosten plötzlich um 50 Prozent oder mehr steigen.
Verwalter stehen zwischen den Fronten: Sie müssen erklären, warum ein jahrelang solider Vertrag plötzlich gekündigt wird oder die Beiträge explodieren. Gleichzeitig erwarten Eigentümer Lösungen – am besten ohne Mehrkosten. In der Praxis höre ich immer häufiger: „Können Sie das nicht regeln?" Kann ich – aber die Optionen werden dünn.
Rückzug statt Risikoausgleich
Die Grundidee der Versicherung – viele sichern gemeinschaftlich das Risiko einzelner ab – gerät durch Klimarisiken und regionale Schadenkonzentration ins Wanken. Wenn Schäden immer häufiger und in immer kürzeren Abständen auftreten, funktioniert das klassische Kollektivprinzip nur noch eingeschränkt.
Versicherer reagieren mit Rückzug und Risikoselektion:
- Regionen mit hoher Schadenfrequenz werden aus der Zeichnung ausgeschlossen
- Selbstbeteiligungen werden massiv angehoben
- Gebäudewerte werden neu bewertet und teils überproportional erhöht
Das ist ein Dilemma: Einerseits müssen Versicherer wirtschaftlich handeln, andererseits verliert die Versicherung so ihre gesellschaftliche Schutzfunktion. Und wir Makler stehen vor der Frage: Wie vermitteln wir noch, wenn kaum noch jemand zeichnet?
Elementarschäden als Wendepunkt
Die Diskussion um eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden hat das Thema in die Öffentlichkeit gebracht – akute Entlastung bringt sie nicht. Der Schutz bleibt freiwillig und entsprechend ungleich verteilt. In Regionen mit geringem Risiko verzichten viele Eigentümer aus Kostengründen, während in Hochrisikogebieten die Prämien für eine Komplettabsicherung oft unbezahlbar sind.
Dabei zeigt sich: Extreme Wetterereignisse treffen längst nicht mehr nur klassische Risikogebiete. Starkregen, Überschwemmungen und Stürme treten flächendeckend auf. Die Grenze zwischen „sicher" und „gefährdet" verschwimmt – und damit auch die Kalkulationsgrundlage der Versicherer.
Die Rolle der Makler
Für uns Makler bedeutet das eine doppelte Aufgabe: Wir müssen bestehende Risiken realistisch einschätzen und Kunden über notwendige Anpassungen informieren. Gleichzeitig gilt es, Vertrauen zu bewahren – gerade dann, wenn Beiträge steigen oder Leistungen eingeschränkt werden.
Das erfordert ein tiefes Verständnis der Marktmechanismen und ehrliche Kommunikation. Es reicht nicht mehr, einfach den günstigsten Anbieter zu finden. Entscheidend ist: Warum wird ein Tarif teurer? Welche Leistungen sind im Schadensfall wirklich relevant? Und vor allem: Wer zeichnet überhaupt noch?
Die Beratung wird wieder zum Kern unserer Arbeit – nicht als Verkaufsinstrument, sondern als Aufklärung und Orientierung.
Fazit: Ein Markt im Stresstest
Die Wohngebäudeversicherung steht exemplarisch für die Herausforderungen der gesamten Versicherungsbranche: Klimawandel, Inflation, steigende Kundenerwartungen und ein sich wandelndes Risikobewusstsein.
Wenn ganze Anbietergruppen aus dem Markt verschwinden, wird klar: Klassische Modelle geraten an ihre Grenzen. Eine nachhaltige Lösung kann nur darin bestehen, Risiken fairer zu verteilen, Prävention zu fördern und das Bewusstsein für die tatsächlichen Werte hinter jeder Immobilie zu schärfen.
Schlagzeilen
Allianz: Jannik Sinner wird Markenbotschafter
Berufsunfähigkeit und Finanzplanung: Große Lücken bei Erwerbstätigen
Pflegeversicherung: Eigenanteile für Pflege springen auf Rekordwert
Klimaschäden und Versicherung: Wo die Grenzen der Versicherbarkeit liegen
Diese Krankenkassen gelten als „Vorbilder unternehmerischer Verantwortung“
In einem Markt, der zunehmend von Unsicherheit geprägt ist, wird Orientierung zum entscheidenden Mehrwert. Und die können wir als Makler bieten – wenn wir ehrlich über die Grenzen des Systems sprechen.
Anzeige