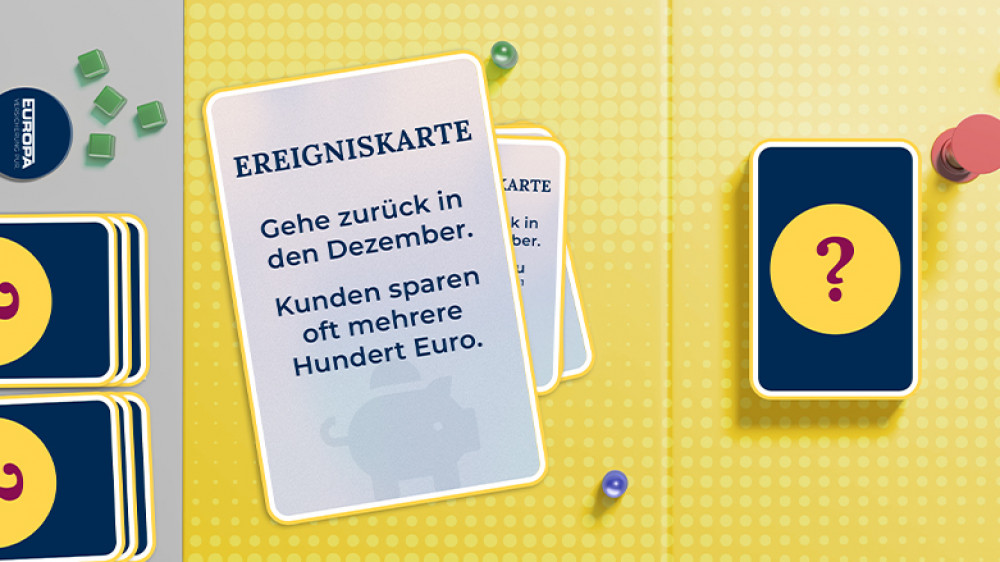“Nun sag, wie hast du’s mit der Standardsoftware?”
Für die Versicherungsbranche stellen sich im Rahmen der Digitalisierung eine Reihe von entscheidenden Fragen. Eine der wichtigsten bei der künftigen Ausrichtung jeder einzelnen Gesellschaft ist Entscheidung für das Kernsystem. Was soll die Standardsoftware können und wer soll die Software entwickeln. Es ist die Gretchenfrage, meint PPI-Vorstand Dirk Weske. In seiner Kolumne für Versicherungsbote beleuchtet er den Umsetzungsstand der Digitalisierung innerhalb der Branche.

“Nun sag', wie hast du's mit der Religion?” Keine Sorge, ich möchte an dieser Stelle keine spirituelle Diskussion aufmachen. Ich zitiere den als “Gretchenfrage” berühmt gewordenen Satz aus Goethes “Faust” aus einem anderen Grund. Denn auch die Versicherungsbranche hat ihre ganz eigene Gretchenfrage. Sie lautet: Wie hältst du es mit der Standardsoftware? Make or Buy, Eigenentwicklung oder Standardsoftware?
Anzeige
Die Praxis zeigt, dass diese Frage für Umsysteme und Komplettlösungen weitestgehend in Richtung von Standardsoftware beantwortet ist. Für Kernsysteme wie Antrag, Bestand, Produkt, Provision, Schaden und Partner ist sich der Markt aber so unschlüssig wie Faust bei der Frage nach der Religion.
Versicherer betonen in diesem Zusammenhang gerne die Einzigartigkeit ihrer Produkte und Prozesse. Insbesondere spezialisierte Versicherer schließen eine Standardlösung oft aus. Das Hauptversprechen der Eigenentwicklung – Wettbewerbsvorteile durch maximale Kontrolle und Flexibilität – erweist sich in der Realität jedoch oft als trügerisch: Durch komplexe Schnittstellenintegrationen bremsen sich flexible Eigenentwicklungen häufig selbst aus. Hinzu kommt, dass nicht-wertschöpfende „regulatorische Features“ zunehmend die knappen (Weiter-)Entwicklungsbudgets belasten.
Standardsoftware bringt hier auf den ersten Blick klare Vorteile. Richtig eingeführt, nutzt sie etablierte Branchenstandards, reduziert den Aufwand bei der Schnittstellenintegration und verteilt die Kosten von regulatorischen Features auf viele Schultern. Demgegenüber steht aber auch eine klare Gewinnerzielungsabsicht bei Standardsoftwareherstellern und ein faktischer „vendor lock-in“ bei allen kritischen und tief in die Betriebsprozesse integrierten Systemen.
Ein nicht auf den ersten Blick ersichtlicher Zusammenhang ergibt sich aus den Konsequenzen der Einführung von Standardsoftware – zumindest, wenn diese Einführung „nah am Standard“ erfolgt. Denn eine Einführung nahe am Standard zwingt Unternehmen dazu, eingefahrene Prozesse zu hinterfragen: Bringt dieser Spezialprozess wirklich einen Wettbewerbsvorteil am Markt? Wo gibt es Redundanzen? Wie stark können Abläufe automatisiert werden? Solche Fragen werden bei Eigenentwicklungen leider nicht immer gestellt. Etablierte Muster, die ursprünglich aus der Not und mangelnden Alternativen heraus geboren wurden, werden in der Eigenentwicklung häufig 1:1 nachgebildet, ohne sie zu hinterfragen – mit dem Ergebnis, dass wesentliche Optimierungspotenziale ungenutzt bleiben.
Auf der anderen Seite: Jede Optimierung von Prozessen ist natürlich auch eine Änderung von Prozessen. Und jede Neuerung bringt Widerstand mit sich, den es angemessen zu behandeln gilt, damit Veränderungen nicht blockiert werden. Daher ist ein gutes und vor allem explizites Change-Management insbesondere auch bei der Einführung von Standardsoftware ein kritischer Erfolgsfaktor – denn Einführung von Standardsoftware verändert ein Unternehmen meist mehr als eine (in der Regel) eher inkrementelle Veränderung durch Eigenentwicklung.
Was ist also die Antwort auf die eingangs gestellte Gretchenfrage?
Eine pauschale Antwort gibt es - das wird Sie wenig überraschen - nicht. Standardsoftware ist nicht notwendigerweise eine Einschränkung, sondern kann über die reine Funktion hinaus zur Investition in Flexibilität und Effizienz des Gesamtunternehmens werden. Umgekehrt kann eine Eigenentwicklung in gut durchdachten Szenarien den kritischen Wettbewerbsvorteil ausmachen, der am Markt den Unterschied zwischen Erfolg und Überleben ausmacht.
In meiner Praxiserfahrung gibt es erfolgreiche Beispiele sowohl für Eigenentwicklungen als auch die Einführung von Standardsoftware. Ich kann daher nur anregen, diese Frage wirklich ergebnisoffen, differenziert und von allen Seiten zu betrachten.
Schlagzeilen
Debeka: Verbraucherschützer ziehen mit Sammelklage in den Storno-Streit
Beitragsrekord in der Sozialversicherung: DAK-Chef sieht 'letzten Warnschuss für Reformen'
Diese Versicherer gelten als Vorbilder unternehmerischer Verantwortung
Arbeitsministerin Bärbel Bas: 'Unser Sozialstaat muss gerechter werden'
Wohngebäudeversicherung: So hoch sind Beiträge für Elementarschutz
Bei Goethe scheut Faust übrigens eine klare Antwort auf die Frage nach der Religion – und markiert damit den Wendepunkt, an dem die Tragödie ihren unaufhaltsamen Lauf nimmt.
Anzeige