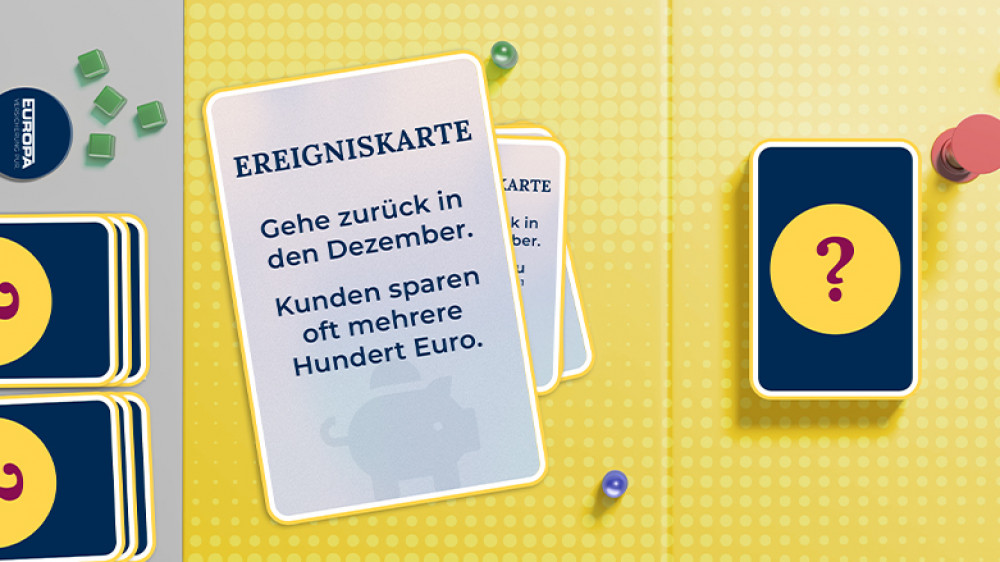Krankenversicherung: Versicherer blockieren Solidarität
Zwei Systeme, zwei Logiken – und ein wachsendes Problem: Während die gesetzliche Krankenversicherung auf Solidarität basiert, zieht die private Krankenversicherung die „guten Risiken“ an und entzieht sich dem Gemeinwesen. Alwin W. Gerlach kritisiert im Gastbeitrag die Folgen der Doppelstruktur und fordert einen neuen Gesellschaftsvertrag Gesundheit.
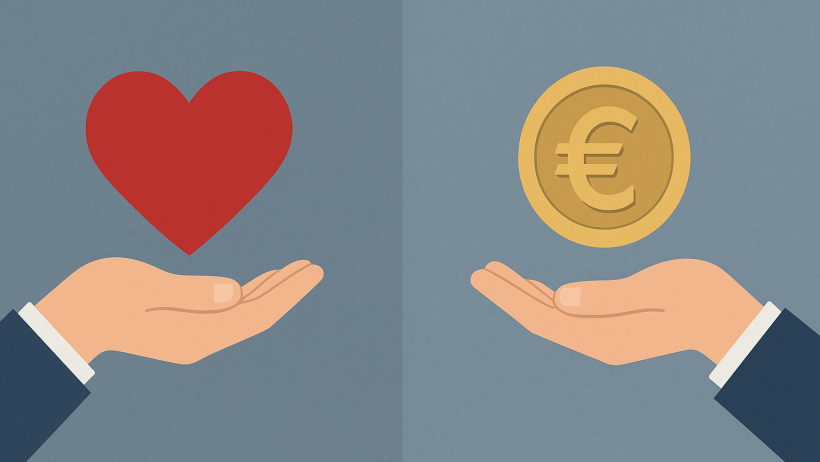
- Krankenversicherung: Versicherer blockieren Solidarität
- Geflüchtete und Asylsuchende – ein Flickenteppich
- Wege zur Reform - Ein neuer Gesellschaftsvertrag
Dieser Beitrag ist geschrieben als kritische Beleuchtung des gegenwärtigen Systems. Es wird die Frage aufgeworfen, warum Beitragszahler dauerhaft Kosten für Nicht-Beitragszahler übernehmen, während Privatversicherte hiervon ausgeschlossen sind. Ein Dilemma, das mich als frühere Führungskraft in dieser Branche seit langem bewegt und das ich hier mit Blick auf Klarheit und Adäquanz im Rahmen der Solidarität unserer Wertegemeinschaft kritisch beleuchte.
Anzeige
Ein System, das alle betrifft – und doch spaltet
Es gibt Bereiche in der Politik, die viele für abstrakt halten – Außenpolitik, Energiewende, europäische Verträge. Doch kaum etwas ist so unmittelbar wie die Frage: Bin ich im Krankheitsfall abgesichert? Und vor allem: Werde ich so behandelt, wie es meiner Krankheit entspricht – oder wie es mein Versicherungsstatus erlaubt?
Deutschland gilt international als vorbildlich: Nahezu die gesamte Bevölkerung ist krankenversichert, existenzielle Notlagen durch Krankheit sind selten. Dennoch verbirgt sich hinter dieser Sicherheit ein Paradox. Wir leisten uns eine Doppelstruktur: eine gesetzliche Krankenversicherung (GKV) für die große Mehrheit, und daneben eine private Krankenversicherung (PKV) für Beamte, Selbstständige und Besserverdienende.
Was historisch gewachsen ist, wird heute zunehmend zur sozialen und ökonomischen Schieflage. Denn zwei Systeme bedeuten nicht automatisch mehr Vielfalt. Sie bedeuten vor allem: ungleiche Chancen, doppelte Verwaltung, verzerrte Anreize – und einen stetigen Verlust an Solidarität.
Zwei Systeme, zwei Logiken – und ein gemeinsames Problem
Die GKV basiert auf Solidarität. Einkommen wird bis zur Beitragsbemessungsgrenze verbeitragt, die Gesunden tragen die Kranken, die Jungen die Alten. Sie sichert auch Menschen ohne hohes Einkommen oder mit Vorerkrankungen ab. Sie ist das Rückgrat des deutschen Sozialstaats. Die PKV hingegen folgt der Äquivalenzlogik: Jeder zahlt seinen eigenen risikoäquivalenten Beitrag. Wer jung, gesund und einkommensstark ist, zahlt wenig. Wer alt wird oder erkrankt, erlebt sprunghafte Beitragssteigerungen. Familienfreundlichkeit fehlt: Kinder müssen einzeln versichert werden.
Das Ergebnis: Die PKV zieht die „guten Risiken“ an, die GKV bleibt mit den „teuren Risiken“ zurück. Für Ärzte und Kliniken bedeutet das: Privatpatienten bringen höhere Honorare, also bessere Deckungsbeiträge. Das wirkt sich auf die Versorgung aus. Privatversicherte bekommen schneller Termine, gesetzlich Versicherte warten länger – nicht weil die Medizin unterschiedlich wäre, sondern weil die Vergütung es ist. Diese Zwei-Klassen-Erfahrung untergräbt das Vertrauen. Denn Patienten vergleichen nicht die Bilanzen der Kassen, sondern die Realität im Wartezimmer.
Die unsichtbare Kostenlawine
Hinzu kommt die Demografie. Deutschland altert. Mit dem Alter steigen chronische Erkrankungen: Diabetes, Herz-Kreislauf, Krebs, Demenz. Jeder zusätzliche Lebensjahrgang kostet mehr Behandlungen, mehr Medikamente, mehr Pflege. Während in den 1970er-Jahren viele Menschen kurz nach Renteneintritt starben, erleben wir heute zwei Jahrzehnte voller medizinischer Begleitung.
Schlagzeilen
Tierhalterhaftpflicht: Diese Anbieter gelten als besonders fair
Tierkrankenversicherung: Diese Anbieter regulieren besonders fair
Zukunft der Versicherer: Künstliche Intelligenz, Datenpartnerschaften und Klimarisiken
Vertrauen im KI-Zeitalter: Die Bewährungsprobe für Versicherer
Value schlägt Mode: Mehrwert in der strategischen Asset Allocation
Gleichzeitig schrumpft die Zahl der Beitragszahler. Weniger junge Menschen tragen mehr Ältere. Das Verhältnis von Beiträgen zu Ausgaben kippt. Die GKV reagiert mit steigenden Beitragssätzen, die PKV mit drastischen Beitragssprüngen im Alter. In beiden Fällen ist das System immer weniger tragfähig.
Anzeige
Zugleich treibt der medizinische Fortschritt die Kosten. Neue Gentherapien oder Krebsmedikamente sind medizinisch wertvoll, kosten aber Hunderttausende Euro pro Patient. Sie retten Leben – und belasten die Budgets. Es ist die stille Kostenlawine, die im Alltag unsichtbar bleibt, aber die Systeme Jahr für Jahr erschüttert.
Geflüchtete und Asylsuchende – ein Flickenteppich
Ein drittes Glied der Ungleichheit betrifft Geflüchtete und Asylsuchende. Sie fallen anfangs unter das Asylbewerberleistungsgesetz. Versorgt wird nur, was akut oder schmerzhaft ist. Chronische Leiden, psychische Traumata, Vorsorgeuntersuchungen – Fehlanzeige. Erst nach längerer Zeit oder Anerkennung erfolgt Zugang zur vollen GKV.
Das ist politisch motiviert, aber medizinisch kurzsichtig. Krankheiten verschlimmern sich unbehandelt, psychische Störungen verfestigen sich, am Ende sind die Folgekosten höher. Dolmetscher fehlen, bürokratische Hürden verhindern rechtzeitige Behandlung. Kommunen zahlen die Zeche, und ein Flickenteppich aus lokalen Lösungen führt zu Willkür.
Anzeige
Ein solidarisches Gesundheitssystem darf nicht nach Aufenthaltsstatus sortieren. Einheitliche Regeln, Integration in die GKV, Finanzierung durch Bund und Länder wären nicht nur gerechter – sie wären langfristig ökonomisch vernünftiger.
Ungleichheit im Alltag
Die Spaltung zeigt sich nicht in Paragrafen, sondern im Alltag:
- Der gesetzlich Versicherte wartet wochenlang auf einen Facharzttermin.
- Die Privatpatientin bekommt ihn sofort.
- Der Geflüchtete muss für die Notfallversorgung kämpfen.
Die Unterschiede beruhen nicht auf medizinischer Dringlichkeit, sondern auf Versicherungsstatus und Zahlungsfähigkeit. Das widerspricht dem Kern dessen, was Gesundheit im Gemeinwesen bedeutet: dass jeder Mensch gleich viel wert ist, unabhängig vom Geldbeutel.
Die Macht der Versicherer
Warum ändert sich nichts? Weil die Versichererlobby, insbesondere die PKV, jede Reform blockiert, die Solidarität stärken würde. Die PKV lebt davon, gute Risiken abzusondern. Junge Beamte, Selbstständige, Gutverdienende – sie alle entziehen sich dem Solidartopf der GKV. Für die PKV ist das profitabel. Für die Gesellschaft ist es fatal.
Mit professioneller Lobbyarbeit wird jeder Reformvorschlag bekämpft:
- Bürgerversicherung? Sofort als „Einheitsmedizin“ diffamiert.
- Breitere Finanzierungsbasis? Abgelehnt als „Zwangsversicherung“.
- Gleiche Honorare für GKV und PKV? Abgewehrt mit dem Argument der „ärztlichen Freiheit“.
Dabei ist die Realität anders: Innovationen, Nutzenbewertungen, Preisverhandlungen mit Pharma und MedTech – all das leistet die GKV. Die PKV profitiert oft von Strukturen, die sie selbst nicht trägt.
Die PKV-Lobby verteidigt Klientelinteressen, nicht das Gemeinwohl. Und die Politik hat zu oft nachgegeben, weil diese Lobby laut, gut vernetzt und finanziell stark ist. Doch damit wird die Spaltung zementiert.
Wege zur Reform - Ein neuer Gesellschaftsvertrag
Es gibt Wege aus der Sackgasse. Keine radikale Revolution, sondern kluge Schritte, die Solidarität neu beleben:
- Breitere Beitragsbasis in der GKV. Auch Beamte, Selbstständige und Kapitaleinkünfte müssen einbezogen werden.
- Vergütungskonvergenz. Standardleistungen müssen gleich bezahlt werden – unabhängig vom Versicherungsstatus.
- PKV als Zusatzversicherung. Sie kann Komfort sichern, aber nicht Grundversorgung spalten.
- Integration Geflüchteter. Einheitliche Regeln, Finanzierung durch Bund und Länder, Dolmetscherleistungen im Katalog.
- Transparenz. Wartezeiten, Behandlungsergebnisse, Kosten: öffentlich und vergleichbar. Nur wer misst, kann steuern.
Ein neuer Gesellschaftsvertrag
Das deutsche Krankensystem schützt viele, aber es teilt zu viele. Es ruht auf Solidarität, erlaubt aber Ausnahmen, die diese Solidarität aushöhlen. Es garantiert Versorgung, aber nicht gleiche Chancen.
Schlagzeilen
Hausratversicherung: Dies sind die fairsten Schadenregulierer
Allianz: Jannik Sinner wird Markenbotschafter
Berufsunfähigkeit und Finanzplanung: Große Lücken bei Erwerbstätigen
Pflegeversicherung: Eigenanteile für Pflege springen auf Rekordwert
Klimaschäden und Versicherung: Wo die Grenzen der Versicherbarkeit liegen
Wenn wir nicht gegensteuern, erodiert das Vertrauen weiter – und ohne Vertrauen zerfällt jedes Versicherungssystem. Wir brauchen einen neuen Gesellschaftsvertrag Gesundheit. Einen Vertrag, der sagt: Krankheit ist kein Markt, sondern ein Schicksal, das jeden treffen kann. Und diesem Schicksal begegnen wir gemeinsam.
Anzeige
Die privaten Versicherer blockieren Solidarität. Aber die Frage ist nicht, ob sie ewig blockieren können – sondern wann Politik und Gesellschaft den Mut haben, die Regeln neu zu schreiben. Für ein System, das nicht nur leistungsfähig, sondern auch gerecht ist. Abschließende Bemerkung: Es gibt keinen Raum mehr für endlose Diskussionen. Was es jetzt braucht, ist ein breiter Raum für Offenheit, Ehrlichkeit und Klarheit – und daraus den Mut zu handeln und zu entscheiden. Für ein Gesundheitssystem, das der Gerechtigkeit verpflichtet bleibt und der Wertegemeinschaft dient.
- Krankenversicherung: Versicherer blockieren Solidarität
- Geflüchtete und Asylsuchende – ein Flickenteppich
- Wege zur Reform - Ein neuer Gesellschaftsvertrag