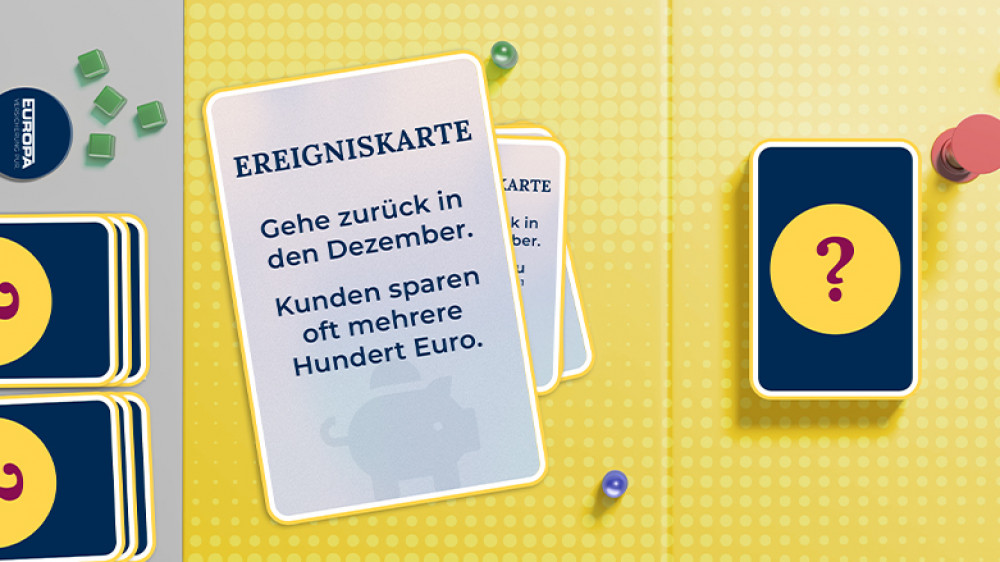Wirtschaftsweiser fordert Transparenz bei versicherungsfremden Leistungen in den Sozialversicherungen
Der Wirtschaftsweise Martin Werding warnt vor der Intransparenz bei versicherungsfremden Leistungen in den Sozialversicherungen. Der Ökonom fordert eine verbindliche Definition und klare Zuordnung der Kosten. Denn ohne Transparenz droht die verdeckte Belastung der Versicherten weiter zuzunehmen.

Anzeige
Die Finanzierung der Sozialversicherungen in Deutschland steht vor massiven Herausforderungen. Das gilt nicht nur aufgrund der Demografie, sondern auch wegen der Thematik der versicherungsfremden Leistungen. Gemeint sind Ausgaben, die nicht auf eingezahlten Beiträgen beruhen, sondern gesamtgesellschaftliche Aufgaben erfüllen und die trotzdem von den Sozialkassen getragen werden. Rentenansprüche für Kindererziehungszeiten, die Rente mit 63 oder die Angleichung der Ostrenten sind prominente Beispiele.
Der Ökonom Martin Werding bringt es im Gespräch mit der "Zeit" auf den Punkt: „Der Bund generiert immer wieder zusätzliche Lasten für die Sozialversicherungen – übernimmt sie aber nicht vollständig oder zieht Mittel kurzfristig ab“. Resultierend daraus folgen höhere Beiträge für Versicherte und geringere Rentenanpassungen.
Die Dimensionen sind beachtlich. Denn laut Deutscher Rentenversicherung beliefen sich die beitragsfremden Leistungen 2023 auf mindestens 63,2 Milliarden Euro – nach einer erweiterten Definition sogar auf 124,1 Milliarden Euro. Der Bundeszuschuss lag im selben Jahr jedoch nur bei 84,3 Milliarden Euro. Fast 40 Milliarden Euro mussten also aus Beiträgen der Versicherten gestemmt werden.
Auch in der Krankenversicherung ist das Defizit offenkundig. So zahlte der Bund 2022 pro Bürgergeldempfänger lediglich 108 Euro, während die tatsächlichen Kosten bei 311 Euro lagen. Die Differenz von rund 9,2 Milliarden Euro trugen die Beitragszahler. Werding nennt dies „einen klaren Fall für eine versicherungsfremde Leistung, der nicht in Ordnung geht.“
Das Kernproblem: Es gibt keine verbindliche gesetzliche Definition, was als versicherungsfremd gilt. Diese Intransparenz hat handfeste politische Vorteile. „Die Intransparenz verschafft dem Bund größere Gestaltungsspielräume und erlaubt haushaltspolitische Notoperationen“, erklärt Werding. Dadurch könne die Regierung neue Leistungen ins System „drücken“, ohne sofort offenlegen zu müssen, wie sie finanziert werden sollen.
Werding fordert deshalb eine verbindliche Festlegung, welche Leistungen versicherungsfremd sind, und eine konkrete Zuordnung der Kosten im Bundeszuschuss. So ließe sich klar nachvollziehen, ob die staatlichen Zahlungen ausreichen. Auch der Bundesrechnungshof unterstützt diesen Ansatz.
Darüber hinaus müsse der Bund seine Ausgabenpolitik ändern. „Werde eine Leistung erweitert, müsse der Bundeszuschuss entsprechend steigen“, betont Werding. Gleichzeitig sollten versicherungsfremde Leistungen auslaufen, statt ständig neue zu schaffen. Als Beispiel nennt er die Witwenrente, die heute eher einer „Umverteilung zugunsten bestimmter Lebensformen“ gleiche und durch ein Rentensplitting ersetzt werden könne.
Für die Sozialversicherungen geht es um nicht weniger als ihre finanzielle Stabilität. Ohne mehr Transparenz droht eine schleichende Belastungsverschiebung und diese kommt mit steigenden Beiträgen und sinkender Akzeptanz einher. Dem pflichtet auch TK-Chef Jens Baas bei: „Die Regierung muss handeln, denn Versicherte und Wirtschaft können auf Dauer nicht weiter belastet werden"
Die Reaktionen in derartige Richtungen dürften jedoch überschaubar sein. Denn alle Politiker oder Ökonomen, die zuletzt Reformen angemahnt hatten, spürten umgehend die mediale und politische Breitseite. Ein Sturm der Entrüstung machte sich breit. Dies geschah frei nach dem Motto: „Hängt den Überbringer der schlechten Nachricht".
Dieses Szenario hatte zuletzt unter anderem die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer beobachtet und warnte, dass sich die Parteien aus Angst vor Wählerverlusten vor einer Reform des Rentensystems scheuen würden. So hatten sich die Unionsparteien im letzten Jahr noch offen für eine Erhöhung des Renteneintrittsalters sowie eine Reduzierung der Rente mit 63 gezeigt. „Es gab noch diese Vorschläge. Die sind alle einkassiert worden. Ich kann das nur so interpretieren, dass man Sorge hat, im Wahlkampf schlecht auszusehen“, kritisierte Schnitzer.
Damit bekräftigte sie ihren Vorwurf, den sie bereits in einem Interview in der Fachzeitschrift "Aktuar Aktuell" herausgestellt hatte (Versicherungsbote berichtete): „Leider hat sich seit meiner Tätigkeit im Sachverständigenrat durch den Kontakt zu vielen politischen Entscheidungsträger:innen mein Eindruck verfestigt, dass alle vor ernsthaften Reformen zurückscheuen, aus Sorge, die Wählergunst zu verlieren.“