Lebensversicherung: BaFin bemängelt Vertrieb von Netto-Policen
Die BaFin hat beim Vertrieb von Netto-Versicherungsanlageprodukten schwere Mängel entdeckt. Versicherer schieben Verantwortung ab, Beratung bleibt lückenhaft und der Kundennutzen ist häufig nicht nachvollziehbar. Nun zieht die Aufsicht erste Konsequenzen.
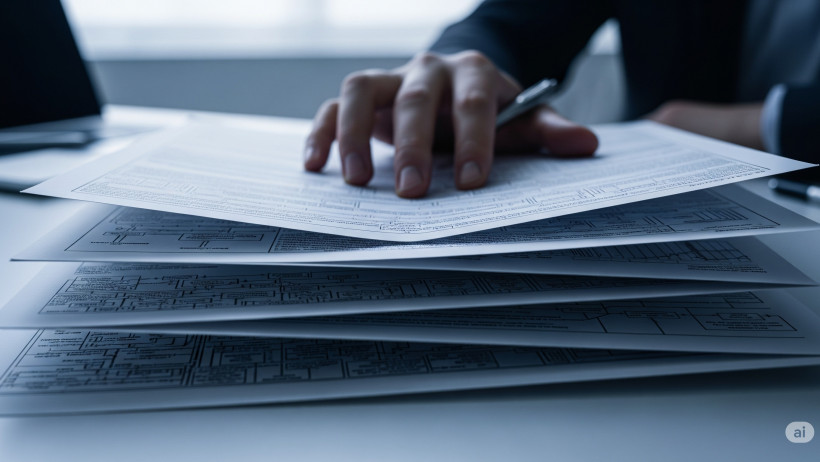
Die Finanzaufsicht BaFin hat 22 Versicherungsunternehmen unter die Lupe genommen und dabei teilweise ernüchternde Ergebnis erzielt. Beim Vertrieb von Netto-Versicherungsanlageprodukten hapert es oft an Beratung, Transparenz und am Kundennutzen. Eine Vielzahl der Versicherer hält sich nicht an die gesetzlich geforderten Pflichten und überträgt Verantwortung auf die Vermittlerschaft.
Anzeige
Nettoprodukte gelten als kosteneffiziente Alternative zur klassischen provisionsbasierten Bruttopolice. Doch die Untersuchung zeigt, dass dieser Vorteil häufig konterkariert wird. Dies kann durch fehlende Standards, unklare Verantwortlichkeiten und eine unzureichende Aufklärung der Versicherten sein.
Viele der befragten Versicherer verwiesen im Rahmen der BaFin-Untersuchung darauf, dass die Beratung über die Unterschiede zwischen Brutto- und Nettotarifen primär Aufgabe der Vermittler sei. Doch das widerspricht geltendem Recht: Nach § 6 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) sind die Versicherer selbst verpflichtet, für eine ordnungsgemäße Beratung Sorge zu tragen – zumindest dann, wenn der Vertrieb nicht durch unabhängige Makler erfolgt.
Doch in der Praxis beschränkt sich die Aufklärung häufig auf den Hinweis, dass sich die Kostenstruktur der beiden Produkttypen unterscheidet. Was jedoch in den wenigsten Beratungsgesprächen zur Sprache kommt: Die gesetzliche Begrenzung der Abschlusskosten bei einer vorzeitigen Vertragskündigung greift bei Bruttopolicen – bei Nettotarifen aber faktisch nicht. Denn die separat vereinbarte und direkt vom Kunden bezahlte Vermittlungsvergütung gilt rechtlich nicht als Abschlusskosten im Sinne des § 169 Absatz 3 VVG. Das führt dazu, dass Kunden bei Kündigung einer Netto-Police deutlich schlechter gestellt sein können als bei einer Brutto-Variante – ohne dies überhaupt zu wissen.
Zudem machten die befragten Versicherer kaum Angaben darüber, ob und wie sie die Angemessenheit der vereinbarten Honorare bewerteten. In vielen Fällen gibt es keine Empfehlungen oder Obergrenzen. Das führt laut BaFin zu einem zentralen Problem: Wenn ein Unternehmen nicht weiß, wie hoch die zusätzliche Belastung für den Kunden durch externe Vermittlungsentgelte ist, kann es den Gesamtnutzen des Produkts nicht beurteilen und verstößt damit gegen § 23 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG), der eine Bewertung des Kundennutzens zwingend verlangt.
Überdies hätten einige Versicherer einzelnen Vertriebswegen spezifische Vorgaben gemacht. Andere Vertriebswege hätten derweil keine Vorgaben gehabt. Die abweichenden Maßstäbe bei der Prüfung des Kundennutzens schaffen zum einen ein ungleiches Regulierungsniveau und können auch das Vertrauen in die Integrität des Produktangebots untergraben.
Rückvergütungen? Ein blinder Fleck.
Ein weiteres Problemfeld offenbart sich bei sogenannten Kick-back-Zahlungen. Denn viele Versicherer wissen nicht, ob ihre Vermittler Rückvergütungen von Fondsgesellschaften erhalten. Auch deren Höhe ist ihnen unbekannt. Dabei könnten diese verdeckten Zahlungen erhebliche Fehlanreize setzen. Vermittler könnten sich bei der Produktauswahl von ihrer eigenen Vergütung leiten lassen und eben nicht vom Kundeninteresse.
Die BaFin weist in ihrem Merkblatt zu wohlverhaltensaufsichtlichen Aspekten bei kapitalbildenden Lebensversicherungen explizit darauf hin: Versicherer müssen Kick-backs identifizieren, bewerten und gegebenenfalls unterbinden. Das gilt insbesondere, wenn diese nicht im Sinne des Zielmarkts sind. Doch auch diese Vorgabe wird bislang nur selten erfüllt.
Schlagzeilen
Provinzial und Versicherungskammer vertiefen Partnerschaft
Crans-Montana: Welche Verantwortung Medien und Versicherungsbranche nach der Katastrophe tragen
Gewerbeversicherungen im Wandel: Was Unternehmen 2026 von der Assekuranz erwarten
Versicherungskammer-Vorständin: „Es herrscht eine große Offenheit für neue Technologien“
BGV-Chef: „Das Einfinden in neue Rollen prägte das Jahr maßgeblich“
Versicherer wie Vermittler sind jetzt gefordert, ihre internen Prozesse zu überarbeiten, Beratungsstandards zu etablieren und die tatsächliche Kostenbelastung für die Versicherten realistisch abzubilden. Die BaFin kündigt an, die Ergebnisse der Untersuchung in ihre Aufsichtspraxis zu integrieren. In einem Fall wurde bereits der Vertrieb eines Nettoprodukts eingestellt. Weitere Maßnahmen könnten folgen, wenn Versicherer nicht zeitnah handeln.
Anzeige

