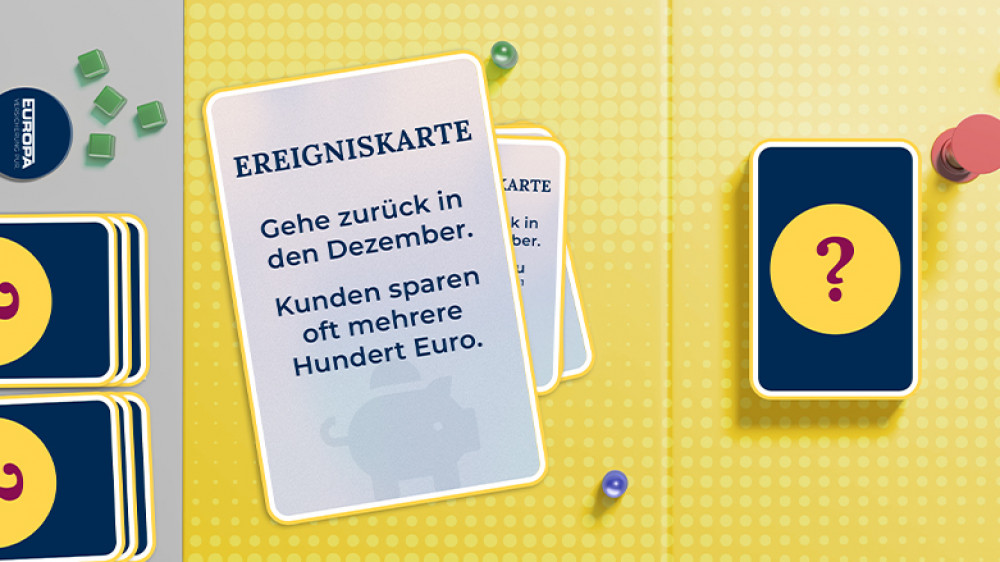Boomer-Soli: Fratzscher und Rürup streiten über die Sonderabgabe für Rentner
Über eine Sonderabgabe auf hohe Alterseinkünfte will das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) die steigende Altersarmut bei Rentnern bekämpfen. Ein Konzept mit Sprengkraft. In einem Interview mit der "Zeit" stehen sich Marcel Fratzscher vom DIW und Rentenexperte Bert Rürup gegenüber. Letzterer warnt vor Ungerechtigkeit und Gefährdung langfristiger Vorsorge.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hatte kürzlich mit dem sogenannten „Boomer-Soli“ eine Sonderabgabe auf sämtliche Alterseinkünfte vorgeschlagen. Ziel sei es, die Rentenkasse zu stabilisieren und gleichzeitig Altersarmut zu bekämpfen. Die Abgabe von zehn Prozent auf alle Alterseinkünfte – nach Abzug eines Freibetrags von rund 1.000 Euro monatlich – würde vor allem Haushalte mit hohen Renten, Pensionen, Kapital- oder Mieteinkünften treffen. Für die reichsten 20 Prozent der Rentnerhaushalte bedeutet das ein um drei bis vier Prozent geringeres Nettoeinkommen. Das unterste Fünftel würde hingegen um zehn bis elf Prozent mehr verfügen. Die Armutsrisikoquote im Alter könnte laut Studie von derzeit rund 18 auf 14 Prozent gesenkt werden.
Anzeige
In einem "Zeit"-Interview sprechen mit Marcel Fratzscher und Bert Rürup zwei etablierte Ökonomen über den Ansatz Boomer-Soli. Fratzscher sieht den Vorschlag pragmatisch: „Weil wir ein Problem haben: Das Armutsrisiko unter Rentnern ist heute schon hoch und wird in den nächsten Jahren massiv steigen. Wenn wir dagegen etwas tun wollen, muss das jemand bezahlen“. Damit setzt er auf eine generationenübergreifende Solidarität und betont ausdrücklich: „Wer finanziell gut dasteht, sollte diejenigen unterstützen, die im Alter kaum über die Runden kommen“.
Rürup: Private Altersvorsorge wird bestraft
Wirtschaftswissenschaftler Rürup hält dagegen: „Man kann nicht einfach sagen: Ab morgen gibt es weniger gesetzliche Rente, geringere Betriebsrenten und kleinere Riester-Renten“ und stellt zugleich in Frage, ob das deutsche Rentenrecht und das Vertrauen der Bürger das zuließen. „Ihr bestraft diejenigen, die privat für ihr Alter vorsorgen", moniert Rürup. Zudem warnt der ehemailige Wirtschaftsweise vor unerwünschten Nebenwirkungen. Denn die zusätzliche Besteuerung würde das Verhalten der Bürger schnell ändern. Statt für das Alter zu sparen, würden sich die Menschen schlicht weniger Geld zurücklegen. „Ich gehe eher davon aus, dass viele Haushalte einen Weg finden werden, die Steuer zu umgehen“, ergänzt der Diplom-Kaufmann.
Fratzscher hält dagegen, die Belastung bleibe moderat: „Nach unseren Berechnungen liegt die durchschnittliche Abgabe bei den 20 Prozent der Haushalte mit dem höchsten Einkommen bei lediglich etwas über vier Prozent, selbst wenn man Kapitaleinkünfte mit einbezieht“. Und für die Haushalte mit geringen Renten bringe der Solidaritätsbeitrag eine Nettoentlastung. Der Professor für Makroökonomie sieht darin eine kluge Umverteilung innerhalb der Generation: „Die Umverteilung stärker innerhalb einer Generation und nicht zwischen den Generationen zu organisieren.“
Die Debatte berührt damit zentrale Fragen der Rentenpolitik: Vertrauen, Stabilität, Generationengerechtigkeit. Rürup verweist auf die historischen Versprechen zur privaten Vorsorge – etwa Riester – und befürchtet nun erhebliche Vertrauensverluste: „Man hat den Menschen geraten, für ihr Alter vorzusorgen […] und nun sollen sie dafür zur Kasse gebeten werden.“
Fratzscher hält dagegen, dass ein Boomer-Soli ökonomisch sinnvoller sei als höhere Beiträge bei den Jüngeren. „Wenn man den Arbeitnehmern immer höhere Steuern und Abgaben aufbürdet, dann leidet darunter die Wirtschaftsleistung.“
Riester-Rente hätte obligatorisch sein müssen
Ein zentraler Kritikpunkt von Rürup richtet sich zudem auf die versäumte Verpflichtung zur Riester-Rente. Ursprünglich war diese als obligatorische Ergänzung zur gesetzlichen Rentenversicherung konzipiert, um Leistungseinbußen im Umlagesystem zu kompensieren. „Der gravierendste Fehler war, dass diese kapitalgedeckte Ergänzung nicht – wie ursprünglich geplant – obligatorisch war“. Unter dem Druck der Boulevardpresse und der Versicherungswirtschaft sei die damalige Regierung eingeknickt, so Rürup. Ein verpflichtendes Modell hätte laut ihm viele der heutigen Herausforderungen gemildert. Er betont, dass es ohne ein Obligatorium kaum möglich sei, das Leistungsniveau der gesetzlichen Rente durch private Vorsorge auszugleichen.
Schlagzeilen
Zukunft der Versicherer: Künstliche Intelligenz, Datenpartnerschaften und Klimarisiken
Vertrauen im KI-Zeitalter: Die Bewährungsprobe für Versicherer
Value schlägt Mode: Mehrwert in der strategischen Asset Allocation
Hausratversicherung: Dies sind die fairsten Schadenregulierer
Allianz: Jannik Sinner wird Markenbotschafter
Auch Fratzscher befürwortet eine ergänzende kapitalgedeckte Rentenkomponente, warnt jedoch vor überzogenen Erwartungen. „Ich finde es richtig, dass wir das Rentensystem um eine kapitalgedeckte Komponente ergänzen. Aber all das wird nicht reichen, um Altersarmut wirksam zu bekämpfen – schon weil Menschen mit wenig Geld in aller Regel kaum etwas zurücklegen können“. Die Wirkung solcher Maßnahmen sei zu langfristig, um das Problem der Altersarmut kurzfristig zu lösen. Eine kapitalgedeckte Komponente könne das System stabilisieren, müsse jedoch durch gezielte Umverteilungsmaßnahmen ergänzt werden, um gerade benachteiligte Gruppen zu schützen.
Anzeige