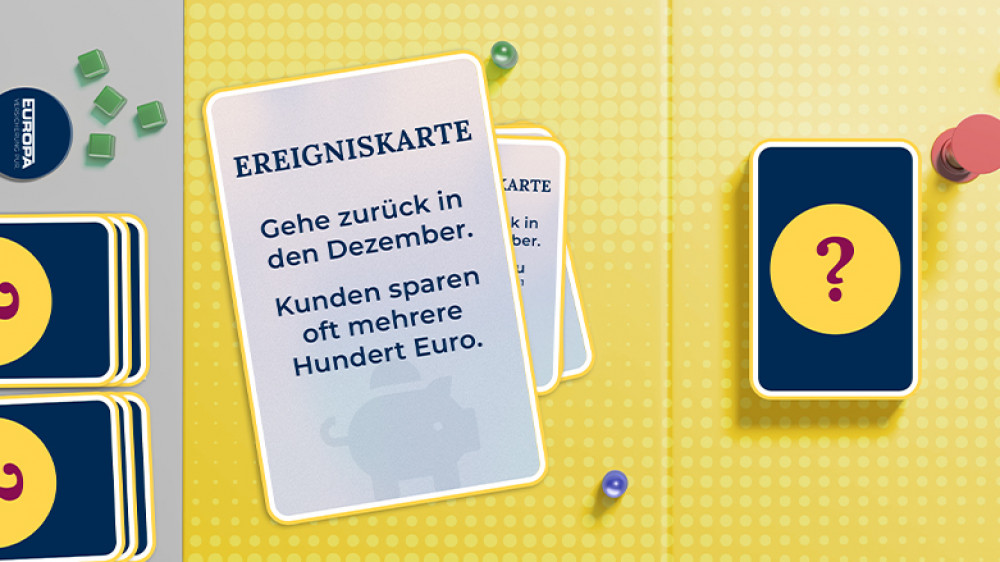Blockchain statt Handschlag: Die Digitalisierung eines jahrhundertealten Prozesses
Die Versicherungsbranche digitalisiert sich langsam, aber unaufhaltsam – Prozess für Prozess, Bereich für Bereich. Eine so konsequente und umfassende Digitalisierung wie die Hanseatische Versicherungsbörse (HVB) findet sich jedoch selten. Die HVB nutzte die Distributed-Ledger-Technologie – häufig bekannt auch unter dem Begriff „Blockchain“ – um ihren traditionellen Underwriting-Prozess der digitalen Welt anzupassen. Ein Vorzeigebeispiel für die Versicherungsbranche, meint PPI-Vorstand Dirk Weske. In seiner Kolumne für Versicherungsbote beleuchtet er den Umsetzungsstand der Digitalisierung innerhalb der Branche.

Über 500 Jahre lang war die Hanseatische Versicherungsbörse der zentrale Marktplatz für den Austausch von Versicherungsnehmern und Versicherern. Seit dem 16. Jahrhundert ging es bei der HVB vorwiegend um die Versicherung des Transports von Gütern um die ganze Welt. Auf der Präsenzbörse wurden diese Versicherungen im direkten Gespräch per Handschlag ausgehandelt. Doch so sehr der „Hanseatische Handschlag“ auch sprichwörtlich für Verlässlichkeit steht – das Modell der Präsenzbörse ist schon lange nicht mehr zeitgemäß, die HVB verlor mehr und mehr an Volumen und damit an Bedeutung. Der Prozess der HVB musste also dringend einer zunehmend vernetzten und schneller werdenden Welt angepasst werden.
Anzeige
Das Problem: Die über die HVB versicherten Risiken sind meist komplex und hochvolumig. Darüber hinaus hochgradig individuell. Um zwei Beispiele zu nennen: der Transport einer Kunstsammlung oder die Brandschutzversicherung eines Industriekomplexes – dafür gibt es keine standardisierten Rahmenverträge. Hinzu kommt, dass ein Versicherer solche Risiken selten allein stemmt, stattdessen wird meist ein (ad hoc) Konsortium aus mehreren Beteiligten geschaffen. Basiert ein solcher Prozess auf unzähligen Telefonaten, E-Mails und hochkomplexen Informationen, ist er ineffizient, intransparent und aufgrund sensibler Daten auch sicherheitskritisch.
So stellte sich die Frage: Wie transferiert man einen hochgradig spezialisierten Handelsplatz ins digitale Zeitalter, ohne dessen ursprüngliche Werte von Transparenz, Sicherheit und Vertrauen zu opfern? Ich habe die Antwort bereits vorweggenommen: durch die Distributed-Ledger-Technologie (DLT), umgesetzt als Blockchain.
Die neue HVB versteht die Börse nun als digitales Ökosystem, in welchem ausschließlich verifizierte Akteure Anfragen und Angebote einstellen, Fragen klären und Dateien austauschen können. Individuelle Risiken einer Anfrage können transparent dargestellt werden, etwa durch den Austausch eines Besichtigungsvideos des zu versichernden Objekts – mit allen Beteiligten gleichzeitig.
Außerdem können alle Akteure transparent zeigen, was für sie aktuell interessant ist. Das spart Zeit. Der Makler sieht sofort, dass, um beim Beispiel der Kunstsammlung zu bleiben, Versicherung A inzwischen keine Kunst mehr versichert. Und die Versicherung bekommt keine entsprechenden Anfragen mehr.
Prinzipiell ließe sich das auch mit einem klassischen Datenbanksystem abbilden. Doch hier scheinen die Vorteile der Distributed Ledger Technologie durch: Die HVB ist ein dezentrales (Peer-to-Peer-)Netzwerk bestehend aus den privaten DLT-Knoten der Mitglieder. Dadurch wird die Hoheit über die eigenen Daten eines jeden DLT-Mitglieds sichergestellt. Darüber hinaus sind alle Aktionen auf der DLT manipulationssicher – das kann insbesondere im Haftungsfall ausschlaggebend sein, denn die DLT zeigt genau, wer welche Daten zu welchem Zeitpunkt zur Verfügung hatte. Und zu guter Letzt ist die DLT beliebig skalierbar, sowohl was die Zahl der Mitglieder als auch was die abzuwickelnden Versicherungsfälle angeht.
Schlagzeilen
Entgeltumwandlung und Krankengeld: Was Arbeitnehmer und Arbeitgeber wissen müssen
VGH startet betriebliche Krankenversicherung aus Neodigital-Baukasten
DEVK steigt bei Assekuradeur ein
Haftpflichtversicherung: Die Schaden-Kosten-Sieger 2024
Altersvorsorge: Junge Menschen wollen mehr tun, fühlen sich aber überfordert
Mit ihrer Transformation von einem physischen Handelsplatz zu einem dezentralen Netzwerk hat die HVB gezeigt, wie Digitalisierung funktioniert: Der Prozess wurde von vorne bis hinten betrachtet, die Anforderungen verstanden und ergebnisoffen die Technologie gesucht, die alle Anforderungen umsetzen kann. Ein Paradebeispiel, von dem viel gelernt werden kann – die HVB ist stets bereit, hier entsprechende Erfahrungen auszutauschen.
Anzeige