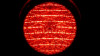BaFin zu mehr Transparenz verpflichtet
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) könnte künftig transparenter Anleger über Ermittlungsergebnisse Auskunft geben müssen, wenn sie gegen Finanzkonzerne klagen. Das hat der Europäische Gerichtshof mit einem Grundsatzurteil bestätigt. Das Problem hierbei: Informationen, die als Geschäftsgeheimnis eingestuft wurden, dürfen erst nach fünf Jahren zugänglich gemacht werden. Das könnte mitunter zu spät sein, um Rechtsansprüche durchzusetzen.

- BaFin zu mehr Transparenz verpflichtet
- Scharfe Kritik an bisheriger Praxis
Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) könnte die Aufsichtsbehörde BaFin zu mehr Transparenz verpflichten, wenn geschädigte Anleger Einblick in Unterlagen und interne Gutachten verlangen, weil sie sich vor Gericht mit Finanzdienstleistern streiten. Werden Unterlagen als „Geschäftsgeheimnis“ eingestuft, verlieren sie demnach möglicherweise ihren vertraulichen Charakter. Das haben die Luxemburger mit einem Grundsatzurteil am Dienstag entschieden, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten (Az. C-15/16).
Anzeige
Das Europäische Gericht hat den Sachverhalt grundsätzlich anders eingeschätzt als der Bundesgeneralanwalt und die BaFin selbst. Beide wollten geschädigten Anlegern den Zugang zu Dokumenten grundsätzlich verweigern, wenn diese nach Artikel 54 der Mifid-Richtlinie als Berufsgeheimnis eingestuft wurden. Nun haben die europäischen Richter dies korrigiert und eine konkrete Vorgabe gesetzt. Informationen, die als Berufsgeheimnis gelten, verlieren demnach nach fünf Jahren grundsätzlich ihren vertraulichen Charakter. Anderes gilt nur, wenn das Unternehmen selbst sich auf die Vertraulichkeit beruft und nachweisen kann, dass es ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung hat.
Aktuell muss jedoch noch im Konjunktiv gesprochen werden, weil auch das Bundesverwaltungsgericht noch ein Wörtchen mitzureden hat. Demnach haben die einzelnen Mitgliedstaaten der EU einen gewissen Spielraum, wie sie europäisches Recht in nationales Recht übersetzen. „Es bleibt abzuwarten, wie das Bundesverwaltungsgericht die Schlussfolgerungen aus Luxemburg umsetzen wird“, zitiert die „Frankfurter Allgemeine“ einen BaFin-Sprecher.
Schneeballsystem - und mangelhafte Finanzaufsicht?
Im konkreten Fall hatte ein Anleger geklagt, der Geld durch die Frankfurter Wertpapierhandelsbank Phoenix Kapitaldienst verloren hatte. Das Unternehmen warb Kundinnen und Kunden per Telefon für Optionsgeschäfte an und versprach zweistellige Renditen von mindestens zehn Prozent. Doch es stellte sich heraus, dass die Anleger einem Schneeballsystem aufgesessen waren. Statt die eingesammelten Gelder in Vermögenswerte zu stecken, wurden Zahlungen an Altkunden zum Teil aus den Geldern neuer Kunden bezahlt. Kontobewegungen bei einem angeblichen Londoner Broker waren zum Teil erfunden, Abrechnungen und Buchungsbestätigungen gefälscht.
In dem Skandal um Phoenix machte auch die Vorgängerbehörde der BaFin eine schlechte Figur. Bereits im Jahr 2000 hatte das damalige Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen dem Unternehmen untersagt, Gelder von Kunden einzusammeln und auf Sammelkonten zu parken. Aber die Frankfurter machten weiter wie bisher und warben unzählige neue Kunden an - ohne, dass die Finanzaufsicht einschritt.
Bis heute ist nicht abschließend geklärt, weshalb die Aufsichtsbehörde wegsah und keine genauere Prüfungen anordnete, denn selbst in den Medien wurde mehrfach über die angeblich skandalösen Machenschaften des Finanzdienstleisters berichtet. Im Jahr 2005 musste Phoenix Kapital schließlich Insolvenz anmelden und die BaFin stellte fest, dass die Anleger zu entschädigen sind. Von den insgesamt 674 Millionen Euro an investierten Geldern erhielten die Betroffenen circa ein Drittel zurück.
Anzeige
Der geschädigte Anleger wollte folglich Einblick in die Akten der BaFin, was denn im Fall der Phoenix Kapitaldienst schief gelaufen war. Dies wurde ihm aber über alle Instanzen verwehrt, auch die BaFin stellte sich dagegen. Schließlich legte das Bundesverwaltungsgericht den Fall in Luxemburg vor, damit das Recht auf Akteneinsicht auf europäischer Ebene geklärt wird. Grundlage für das Urteil ist EU-Richtlinie 2004/39 über Märkte für Finanzinstrumente.
Scharfe Kritik an bisheriger Praxis
Den Geschädigten vor Gericht vertreten hat die Anwaltskanzlei TILP, die im baden-württembergischen Kirchentellinsfurt nahe Tübingen beheimatet ist. Geschäftsführer und Anwalt Peter A. Gundermann hatte bereits vor dem Urteil die gängige BaFin-Praxis scharf kritisiert. Demnach berufe sich die Finanzaufsicht auf einen sehr weiten Begriff der „vertraulichen Information“, der im Grunde dazu führe, dass geschädigte Anleger keinerlei Auskunftsrecht gegenüber der BaFin haben.
„Nach Auffassung der BaFin hätten Bürger ihr gegenüber überhaupt keine Informationsrechte, da quasi alles als vertraulich zu klassifizieren wäre“, sagt Gundermann laut einer Pressemeldung der Kanzlei. „Ein derart weitreichendes, nach unserer Rechtsauffassung völlig unverhältnismäßiges Verständnis der Geheimhaltung fördert allein die Intransparenz der Finanzdienstleistungsbranche gegenüber Bürgern und widerspricht auch den Lehren, die man aus der Finanzkrise ziehen wollte“, so Gundermann.
Anzeige
Fraglich bleibt aber, bei welchen Rechtsstreiten ein Auskunftsrecht nach fünf Jahren nützen würde - zumal vorher wohl geprüft werden müsste, welche Akten überhaupt zugänglich gemacht werden dürfen. Beispiel Falschberatung und Prospekthaftung: Ansprüche verjähren grundsätzlich laut Bürgerlichem Gesetzbuch in zehn Jahren ab Zeichnung der Geldanlage (absolute Verjährung). Oder in drei Jahren, in denen der Anleger Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis von den anspruchsbegründenden Umständen hatte (relative Verjährung).
- BaFin zu mehr Transparenz verpflichtet
- Scharfe Kritik an bisheriger Praxis